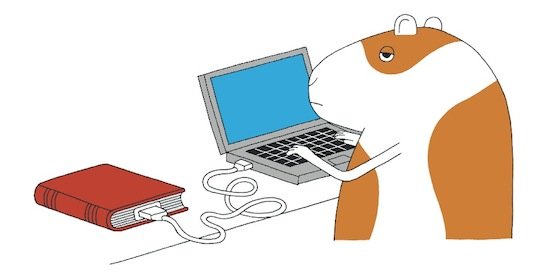Google scannt 400.000 Bücher der Nationalbibliothek ein. Weil der Staat die digitale Revolution verschläft
Gregor Mendel kreuzte Erbsensorten und beobachtete die neu entstandenen Hybriden. Hatten sie weiße oder violette Blüten? Gelbe oder grüne Schoten? Auf diese Weise entdeckte er Mitte des 19. Jahrhunderts die grundsätzlichen Gesetze der Vererbung. Eine revolutionäre Erkenntnis, die den Grundstein der Genetik legte. Nun ist Mendel, 126 Jahre nach seinem Tod, erneut Teil einer Revolution und zwar der digitalen. Wer sein Buch Versuche über Pflanzenhybriden in der Originalausgabe durchblättern wollte, musste bisher die Österreichische Nationalbibliothek aufsuchen. Bald wird ein Ausflug ins Internet genügen. Jeder Internetuser kann dann das Werk lesen, abspeichern und nach Schlagworten durchsuchen. Denn die Nationalbibliothek arbeitet mit Google an der Digitalisierung ihres historischen Bestands. 400.000 alte Bücher werden eingescannt und ins Netz gestellt, das sind 120 Millionen Buchseiten und mehrere Dutzend Terabyte Speicherplatz.
Vor ein paar Jahren schien es wie Science-Fiction, dass einmal ganze Bibliotheken per Knopfdruck online nachlesbar werden und das vollkommen gratis. Bald wird man in der Datenbank nach künstlichen Befruchtungen suchen und Mendels Erstausgabe finden. Powered by Google.
Das ist die Zukunft der Bibliothek. Aber ist es klug, dass ein Milliardenkonzern zur ersten Anlaufstelle für Information, zum Hüter literarischer Schätze wird? Sollte das nicht Aufgabe des Staates sein?
Der Deal zwischen Nationalbibliothek und Google sagt viel über den Übergang zur digitalisierten Wissensgesellschaft aus und darüber, wie die Politik den Anschluss verpasst. Vergangene Woche gab Johanna Rachinger, Generaldirektorin der Nationalbibliothek, freudig die Kooperation mit Google bekannt und sprach von einer Demokratisierung des Wissens.
30 Millionen Euro kostet das Einscannen der 400.000 Bücher, eine Summe, die die Nationalbibliothek selbst nicht aufbringen kann. Google ermöglicht diese Digitalisierung, in Bayern wird der Internetriese die Bände einlesen, es handelt sich dabei ausschließlich um historische Werke aus dem 16. bis 19. Jahrhundert, bei denen das Urheberrecht längst erloschen ist.
Eine Win-win-Situation, urteilte die Presse. Die Nationalbibliothek hat gewissenhaft verhandelt: Sie wird Google nicht naiv den gesamten historischen Bestand in den Rachen werfen, der Internetriese musste zuerst einer Reihe von Auflagen zustimmen. Die Nationalbibliothek bekommt eine Kopie aller Scans und darf diese auch an andere Bibliotheken weiterreichen. Die digitale Version des Kulturschatzes liegt also nicht nur bei dem Datenkraken. Google hat keine Monopolstellung. Das war uns wichtig, deswegen haben wir auch drei Jahre verhandelt, sagt Rachinger.
Dieser Deal habe dem Steuerzahler 30 Millionen Euro erspart, heißt es nun. Das bedeutet auch, dass es dem Staat anscheinend nicht wert war, diese Summe selbst zu investieren, um sein historisches Erbe online zu sichern.
Dabei spricht alles für eine Digitalisierung. 2004 brannte die Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar, 50.000 Bücher zerfielen zu Asche. 2009 stürzte das Kölner Stadtarchiv ein, die Restaurierung des übriggebliebenen Materials wird 30 Jahre dauern. Beim Hofburgbrand im Jahr 1992 konnten wertvolle Bücher gerade noch gerettet werden. Wenn die Werke auch in elektronischer Form und mit Sicherheitskopien vorliegen, ist dieses Wissen viel besser geschützt.
Auch die Forscher reiben sich schon die Hände, die Veröffentlichung im Netz bringt ihnen neue Möglichkeiten. Plötzlich können sie auf jahrhundertealte Texte zugreifen und per Volltextsuche rastern. Wer wissen will, was Zeitgenossen über Prinz Eugen schrieben, hat es künftig leichter. Er kann den Katalog der ÖNB nach Schlagworten durchsuchen und interessante Passagen in Werken finden, die er sonst gar nicht eingesehen hätte. Durch die Digitalisierung werden womöglich spannende Bücher entdeckt, die noch niemand genau studiert hat. Bis 2016 soll der gesamte historische Bestand eingescannt sein.
Was Rachinger nur auf Nachfrage sagt: Sie hatte zuerst versucht, das Geld für die Digitalisierung beim Staat aufzutreiben. Zuständig ist das Unterrichts- und Kulturministerium unter Claudia Schmied (SPÖ). Ich kann aber nicht erkennen, dass wirklich große Summen für eine Digitalisierung in die Hand genommen werden, sagt die ÖNB-Chefin. So stand sie vor der Entscheidung: Solle sie warten, bis sich der Staat eine virtuelle Bibliothek leisten will? Oder gleich mit Google zusammenarbeiten?
Nicht alle jubeln über den Deal. Google ist ein umstrittenes Unternehmen, nicht nur wegen der jüngsten Datenaffäre. Der Konzern aus Kalifornien ist die einflussreichste Marke im Web, so einflussreich, dass es manchen nicht mehr behagt, welche Unmengen an Daten Google anhäuft. Ausgerechnet die Österreichische Nationalbibliothek hilft dem Internetriesen nun, seinen Informationsvorsprung auszubauen. Für den User ist das bequem: Endlich sind diese Informationen gratis im Netz einsehbar und nicht in irgendwelchen Depots versteckt.
Die Politik könnte sich zurücklehnen und das Digitalisieren von Information nur noch privaten Firmen überlassen. Oder sie könnte ein Gegengewicht zu Google sein. In der Theorie versucht die EU das auch. 2008 startete die Europäische Kommission das Projekt Europeana. Die Online-Bibliothek ist die öffentliche Antwort auf Google Books allerdings eine jämmerliche.
Während Googles Scanner auf Hochtouren rotieren, wirkt die Europeana nur traurig. Die Nationalstaaten knausern, deswegen finden sich weniger Werke in den Speichern der europäischen Bibliothek. Der historische Bestand der ÖNB hätte zum Datenschatz der Europeana werden können.
Stattdessen kommt Google zum Zug. Zuerst scannt die Firma die Bücher ein, dann bekommt die Nationalbibliothek eine Kopie davon. Eine Kopie der Kopie geht danach an die Europeana. Das hätte das größte Demokratisierungsprojekt der Europäischen Union werden können, klagt Benedikt Föger, Vorsitzender des Österreichischen Verlegerverbandes. Ihm wäre es lieber, der Staat hätte die 30 Millionen Euro selbst gezahlt, die Werke nicht mit Google geteilt und nur der Europeana gegeben.
Bei dieser Frage geht es ganz grundsätzlich darum, ob man Kulturgüter teilen will noch dazu mit einem privaten Anbieter. Allerdings liefert Google den europäischen Internetusern im Gegenzug auch Werke amerikanischer Bibliotheken, etwa der Universitäten Harvard und Stanford.
Was wirklich fehlte, war die Debatte. Während die Politik schlief und die Öffentlichkeit von nichts wusste, sicherte sich Google die Daten. Bekannt wurde das erst, als die Verträge schon unterschrieben waren. Vielleicht wäre bei einer öffentlichen Diskussion dasselbe Ergebnis herausgekommen. Vielleicht führt kein Weg an Google vorbei, weil die europäischen Staaten viel zu lethargisch sind, um das Potenzial einer Digitalisierung ihres Kulturschatzes zu erkennen. Ob man den Deal begrüßt oder nicht, entscheidend ist letztlich wohl folgende Frage: Ist eine Digitalisierung von privater Hand besser als gar keine seitens der öffentlichen Hand? Die letzten Jahre haben eines deutlich gemacht: Wenn man will, dass Gregor Mendel im Internet landet, wenn man von einer virtuellen Bibliothek und vom Zugriff auf Millionen von Büchern träumt, darf man nicht auf die Eigeninitiative des Staates warten.
Dieser Artikel ist im Falter 25/10 erschienen. Illustration: Jochen Schievink